Main content
Top content
Neues Sprecherteam des Schwerter Arbeitskreises Katholizismusforschung
Dr. Ringo Müller, Dr. David Rüschenschmidt und Prof. Dr. Martin Belz bilden zukünftig ein Dreierteam
26. November 2025

David Rüschenschmidt, Ringo Müller, Martin Belz und Markus Leniger in der Akademie Schwerte, (c) Schwerter Arbeitskreis Katholizismusforschung | Heiner Stahl.
Auf der 39. Jahrestagung des Schwerter Arbeitskreises Katholizismusforschung, die vom 21. bis 23. November 2025 in der Katholischen Akademie Schwerte stattfand, wurde ein neues Sprecherteam gewählt. Nach fünf Jahren Tätigkeit schied Dr. Sarah Thieme (Münster) auf eigenen Wunsch aus dem Leitungsteam aus. Dr. Markus Leniger (Schwerte) und Prof. Dr. Martin Belz (Osnabrück) dankten ihr stellvertretend für die Akademie und den Arbeitskreis herzlich für ihre langjährige Mitwirkung im Leitungsteam. Als Nachfolger wählten die Teilnehmenden der Tagung Dr. Ringo Müller (Erfurt) und Dr. David Rüschenschmidt (Hamburg). Gemeinsam mit Martin Belz, der seine Mitwirkung im Sprecherteam fortsetzt, bilden sie zukünftig ein Dreierteam, das den Arbeitskreis leitet und zusammen mit Markus Leniger von der Akademie Schwerte die Jahrestagungen organisiert.
Wer einen ersten Überblick über die bisherige Forschung des Arbeitskreises gewinnen möchte, findet auf der Homepage weitere Hinweise. Die Bibliografie des Arbeitskreises, die einen konzisen Überblick über die Projekte der letzten Jahre gibt, wird fortlaufend aktualisiert.
Die nächste (40.) Jahrestagung des Arbeitskreises findet vom 20. bis 22. November 2026 in Schwerte statt. Der Call for Papers für die Projektvorstellungen aus dem Nachwuchsbereich wird voraussichtlich im Januar 2026 veröffentlicht werden.
______________________________________________________________________________________
Tagung
Interkulturell glauben, denken und handeln
60 Jahre Zweites Vatikanisches Konzil: weltkirchliche und interkulturelle Perspektiven
21.-22.11.2025
Tagungsort: Haus Ohrbeck, Georgsmarienhütte
Veranstalter:innen
* Prof. Dr. Margit Eckholt, Dr. Severin Parzinger
Institut für Katholische Theologie, Universität Osnabrück, Professur für Dogmatik mit Fundamentaltheologie
* Franziska Birke-Bugiel, Dr. Josef M. Könning
Haus Ohrbeck
"Interkulturell glauben, denken und handeln" ist eine international besetzte Tagung, die das Zweite Vatikanische Konzil aus weltkirchlicher und interkultureller Perspektive in den Blick nimmt.
Nähere Informationen finden Sie hier.
Im Fachbereich Erziehungs- und Kulturwissenschaften ist im Institut für Katholische Theologie an der Universität Osnabrück folgende Professur (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen:
Katholische Theologie:
Altes Testament und Schrifthermeneutik
(Bes.Gr. W3)
Zur Ausschreibung gelangen Sie hier
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kirchengeschichtsdidaktik in Zeiten des CRU
Eine interaktive Werkstatt mit Studierenden und Lehrenden
Das Institut Ev. Theologie & Religionspädagogik der Universität Oldenburg lädt ein
am 21. und 28. November 2025
______________________________________________________________________________

(c) Universität Osnabrück | Foto: Charlotte Diring
Neuer Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Juniorprofessur
Kirchen- und Christentumsgeschichte
15. Oktober 2025
Das Team der Juniorprofessur für Kirchen- und Christentumsgeschichte freut sich, Mag. theol. Michael Neumann, M.A. herzlich als neuen Wissenschaftlichen Mitarbeiter begrüßen zu dürfen.
Nach dem Studium der Katholischen Theologie (Magister theologiae) und der Geschichtswissenschaft (Master of Arts) an der Universität Münster war Herr Neumann im Bereich Wissenschaftskommunikation und Wissenschaftsmanagement am Seminar für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte der Universität Münster tätig. Anschließend arbeitete er als Bildungsreferent beim Bundesverband Katholische Kirche an Hochschulen e.V. in Bonn.
Derzeit promoviert Herr Neumann zum Thema „Das Katholische Büro in Bonn und die Eherechtsreform. Der Wandel der politischen Vertretung religiös legitimierter Interessen zwischen 1949 und 1976“.
An der Juniorprofessur wird Herr Neumann als Elternzeitvertretung das Team verstärken und die Juniorprofessur in Forschung und Lehre unterstützen. Das gesamte Team der Juniorprofessur freut sich auf die Zusammenarbeit und wünscht Herrn Neumann einen erfolgreichen Start bei seiner neuen Tätigkeit.
_________________________________________________________

FEIER.ABEND
Hochschulgottesdienste
Die Katholische Hochschulgemeinde lädt herzlich ein zu den Hochschulgottesdiensten im Wintersemester 2025/26.
Wir feiern mit euch zum Beginn des Semesters Start.Zeit. Das neue Semester beginnt. Neue Herausforderungen, ein neuer Start. Vielleicht bist Du Ersti, vielleicht bist Du mitten im Studium, oder vielleicht liegt auch schon Dein letztes Semester vor Dir und damit der nahende Start ins Berufsleben? Starte mit uns bewusst in das neue Semester mit schöner Musik, vielen alten & neuen Gesichtern und dem Segen Gottes! Und im Anschluss stoßen wir auf das neue Semester an!
START.ZEIT
Mittwoch 15.10.
um 18:30 Uhr
in der Kleinen Kirche
_________________________________
KERZEN.ZEIT
Sonntag, 14.12.
um 18:30 Uhr
in der Kleinen Kirche
________________________________
LESE.ZEIT
Mittwoch 14.01.
um 18:30 Uhr
in der Katharinenkirche
_______________________________
ABSCHLUSS.ZEIT
Mittwoch, 28.01.
um 18:30 Uhr
in der Katharinenkirche
_______________________________
Wer mehr über die KHG erfahren möchte, schaut einfach unter www.kh.-os.de.
_________________________________________________________________

Ein neues Fach „Christliche Religion“ und ein neues Kerncurriculum
„In Niedersachsen gibt es bald ein neues Schulfach: Die evangelischen Kirchen und katholischen Bistümer in Niedersachsen haben am 05.09.2025 in Hannover eine Vereinbarung mit dem Land Niedersachsen über die Einführung des Unterrichtsfachs „Christliche Religion nach evangelischen und katholischen Grundsätzen“ (kurz: Christliche Religion) unterzeichnet.
Anstelle der bisherigen Unterrichtsfächer Evangelische Religion und Katholische Religion wird an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen ein Religionsunterricht eingeführt, der inhaltlich gemeinsam von den katholischen Bistümern und evangelischen Kirchen in Niedersachsen verantwortet wird.
Das Fach wird aufsteigend im Primarbereich und im Sekundarbereich I zum 01.08.2026 verpflichtend eingeführt. In dieser Form ist das Fach einmalig in Deutschland.“
Im August 2025 wurde auch ein erster Entwurf für ein Kerncurriculum für das neue Fach „Christliche Religion“ sowohl für die Sekundarstufe I als auch für die Primarstufe vorgelegt. Die kritische Debatte zu diesem noch nicht öffentlichen Kerncurriculum ist angelaufen. Eine Stellungnahme der hier in Osnabrück am „Lehrstuhl für Religionspädagogik und Pastoraltheologie“ Tätigen findet sich hier
___________________________________________________________________

Blick in den Vortragssaal der Katholischen Akademie Schwerte (c) Katholische Akademie Schwerte / Mike Siepmann
Tagung „Rechtskatholizismus – Zum Verhältnis von Katholizismus und Rechtspopulismus“
39. Jahrestagung des Schwerter Arbeitskreises Katholizismusforschung
vom 21. bis 23. November 2025 in Schwerte
Die Jahrestagung des Schwerter Arbeitskreises bildet ein offenes Forum, das Forscher:innen verschiedener Disziplinen die Möglichkeit bietet, neue Projekte und Fragestellungen in der Katholizismusforschung in kollegialer Atmosphäre zu diskutieren. Die diesjährige Tagung findet vom 21. bis 23. November 2025 in Zusammenarbeit mit der Katholischen Akademie Schwerte statt.
Im Mittelpunkt stehen wie gewohnt die Vorstellung und die Diskussion laufender Arbeiten zur historischen Katholizismusforschung vom 19. bis ins 21. Jahrhundert. Am Sonntagvormittag widmet sich die Jahrestagung im Rahmen der Generaldebatte traditionell einem spezifischen Thema der Katholizismusforschung. Das Thema lautet in diesem Jahr: „Rechtskatholizismus – Zum Verhältnis von Katholizismus und Rechtspopulismus“.
Weitere Informationen und das vollständige Programm der Tagung finden Sie hier
________________________________________________________________________
Summer School: 13.-17. Oktober 2025 in Hannover
Die Summer School richtet sich an Studierende des Lehramtes, an Lehrkräfte aller Fächer sowie Mitarbeitende aus der Schulsozialarbeit. Übernachtung und Verpflegung sind kostenlos.
Zum Abschluss erhalten Sie ein Zertifikat. Die Veranstaltung gilt als Lehrveranstaltung und wird mit 6 CP (Wahlpflichtbereich) angerechnet.
Leitung der Summer School: Prof. Dr. Annett Abdel-Rahman, Prof. Dr. Michael Kiefer (Institut für Islamische Theologie der Universität Osnabrück)
Weitere Informationen finden Sie im Anhang.
____________________________________________________________________

Die Teilnehmenden des Studientages vor der Lambertikirche in Münster (c) Universität Osnabrück | Luca Wijsbeek
Osnabrücker Studierende auf den Spuren der Täuferinnen und Täufer in Münster
Zweiter kirchengeschichtlicher Studientag an der Universität Osnabrück erneut ein Erfolg – Kooperationsprojekt von evangelischen und katholischen Kirchenhistorikerinnen und Kirchenhistorikern an der Universität Osnabrück ging in die nächste Runde
13. Juni 2025
Wer waren die Täuferinnen und Täufer, deren Bewegung im Zeitalter der Reformation entstand? Welche religiösen Vorstellungen leiteten sie? Wie kam es dazu, dass sie in Münster vorübergehend die Macht übernehmen konnten? Und wie wird Täufertum heute gelebt?
Diesen Fragen widmete sich der zweite kirchenhistorische Studientag an der Universität Osnabrück, der von den Kirchenhistorikerinnen und Kirchenhistorikern der Institute für Evangelische und Katholische Theologie am 11. Juni 2025 organisiert wurde. Nach dem großen Erfolg des ersten Studientages im letzten Jahr (zum Bericht siehe hier) ging es dieses Mal mit rund 25 Studierenden nach Münster in Westfalen, den Schauplatz des berüchtigten Täuferreiches von 1534/1535. Die Veranstaltung stand unter dem Titel: „Auf den Spuren der Täuferinnen und Täufer in Münster. Eine erinnerungsgeschichtliche Exkursion im Rahmen des Täuferjubiläums (500 Jahre Täuferbewegung)“.
Als Ausgangspunkt der konfessionell-kooperativen Lehrveranstaltung nahmen die Organisatorinnen und Organisatoren den historischen Beginn des Täufertums, der sich 2025 zum 500. Mal jährt: Im Januar 1525 fand in Zürich die erste Glaubenstaufe statt. Daran erinnern dieses Jahr Gemeinden und Kirchen, die in der Tradition der reformatorischen Täuferbewegung stehen oder sich mit ihr verbunden fühlen, im Rahmen eines vielfältigen Veranstaltungsprogramms.
Mehr erfahren
_________________________________________________________

Die Teilnehmenden der Summer School 2025 (c) Universität Osnabrück | Ringo Müller, Erfurt
Studierende widmen sich geteilter und vereinter Christentumsgeschichte in Ost- und Westdeutschland 1949–1999
Summer School der kirchenhistorischen Professuren in Osnabrück und Erfurt war ein voller Erfolg – Großes Lob für Veranstalter seitens der Teilnehmenden
13. Juni 2025
Die Teilnehmenden der Summer School 2025 (c) Universität Osnabrück | Ringo Müller, Erfurt Die Teilnehmenden der Summer School 2025 (c) Universität Osnabrück | Ringo Müller, Erfurt
Wie gestalteten sich christliche Lebenswelten in Ost- und Westdeutschland nach 1949? Auf welche Weise rezipierten Christinnen und Christen die kirchlichen Reformen und die gesellschaftlichen Transformationsprozesse von den 1950ern bis zur Jahrtausendwende in beiden deutschen Staaten? Welche Veränderungen, Neuaufbrüche und Kontinuitäten zeichneten sich in dieser Zeit auf den Ebenen der Pfarreien und Diözesen, der Kirchen- und Bistumsleitungen sowie der Ordensgemeinschaften ab? Wie setzten sich Gläubige mit unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Systemen auseinander? Und welchen Anteil hatten sie an der friedlichen Revolution 1989/1990?
Diesen und weiteren Fragen rund um das Thema „Christentum im geteilten und vereinten Deutschland 1949–1999“ widmete sich eine interuniversitäre Summer School, die vom 28. Mai bis 1. Juni 2025 in Kooperation durch die Professur für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit an der Universität Erfurt und die Juniorprofessur für Kirchen- und Christentumsgeschichte an der Universität Osnabrück ausgerichtet wurde. Als Tagungsstätte diente das Benediktinerkloster Huysburg bei Halberstadt im Harz, das mit seiner Lage in der Nähe der ehemaligen innerdeutschen Grenze und mit seinem angeschlossenen Tagungshaus den idealen inhaltlichen und organisatorischen Rahmen für die Summer School bot. Gefördert wurde die fünftägige Veranstaltung durch namhafte Zuschüsse der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, des Freundeskreises der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt, der Studienkommission des Fachbereichs 3 und des Instituts für Katholische Theologie der Universität Osnabrück sowie der beiden ausrichtenden Professuren.
Mehr erfahren
____________________________________________________________

Prof. Dr. Martin Belz (c) Universität Osnabrück | Jens Raddatz
Von der Pfarrfamilie zur Gemeinde. Neuer Blogbeitrag von Prof. Dr. Martin Belz erschienen
22. April 2025
Wie veränderten sich Pfarreien und Gemeinden in der Vergangenheit – und welche Bezüge besitzen diese Entwicklungen für die kirchliche Gegenwart? Diesen Fragen widmete sich der Vortrag "Von der Pfarrfamilie zur Gemeinde. Transformationen lokalkirchlicher Vergemeinschaftungskonzepte ca. 1920–1970" von Prof. Dr. Martin Belz im Rahmen des Projekts „Sendung und Sammlung“ des Erzbistums Hamburg am Dienstag, 14. Januar 2025. Vor dem Hintergrund aktueller Transformationsprozesse auf pfarrei- und gemeindekirchlicher Ebene nahm der Referent dabei eine historische Einordnung verschiedener Konzepte lokalkirchlicher Vergemeinschaftung im 20. Jahrhundert vor. Anhand von Beispielen aus seinen eigenen Forschungen vorwiegend zum Bistum Limburg und zur Stadtkirche von Frankfurt am Main ging Martin Belz folgenden Fragen nach: Welche Kirchenbi
lder wurden am konkreten Kirchort jeweils rezipiert? Welche Ausgestaltungen erfuhren diese Bilder in den Feldern der Pastoral und Laienpartizipation, der Liturgie und Katechese sowie im Verhältnis zu Gesellschaft und anderen Konfessionen? Und welche Angebote an Sinnstiftung und Identitätsbildung beinhalteten sie? Zu dem Vortrag erschien nun der Blogbeitrag von Martin Belz auf der Seite des Erzbistums Hamburg unter: https://erzbistum-hamburg.de/Von-der-Pfarrfamilie-zur-Gemeinde-3334.
______________________________________________________________

Nomination procedure academic year 2025/2026 - Universidad Loyola Andalucía
Dear Partner,
Greetings from Universidad Loyola, Spain!
We are happy to announce that the nomination period for the academic year 2025/26 (Fall, Spring and Annual stays) will open on March 15th. There will be a second nomination period for Spring semester students from 14th October - 15th November.
Attached you will find our latest factsheet and below you will find the link for the nomination Platform MoveOn.
Nomination platform:
uloyola.moveonfr.com/form/5a7c08ea8b811b1b7e000002/eng
Nomination period: 15th March - 15th May 2025
For students needing to apply for a student visa, please nominate them as soon as possible, given that processes at the Consulates are taking longer than usual.
It is required that students are equally divided between our Sevilla and Córdoba campuses when the field of studies allows it. You can find more information about this in our Factsheet.
Please do not hesitate to contact us if you have any doubts.
Kind regards,
International Office
UNIVERSIDAD LOYOLA
Campus Córdoba and Campus Sevilla
incoming@uloyola.es
www.uloyola.es
_____________________________________________________________
Einladung zur Tagung: "Interkulturell glauben, denken und handeln"
Vom 21.11. bis zum 22.11.2025 findet im Haus Ohrbeck eine international besetzte Tagung, die das Zweite Vatikanische Konzil aus weltkirchlicher und interkultureller Perspektive in den Blick nimmt, statt.
Veranstalter: Prof. Dr. Margit Eckholt, Dr. Severin Parzinger // Institut für Katholische Theologie, Universität Osnabrück, Professur für Dogmatik mit Fundamentaltheologie
Franziska Birke-Bugiel, Dr. Josef M. Könning // Haus Ohrbeck, Katholische Heimvolkshochschule
Nähere Informationen finden Sie im Anhang.
____________________________________________________________________
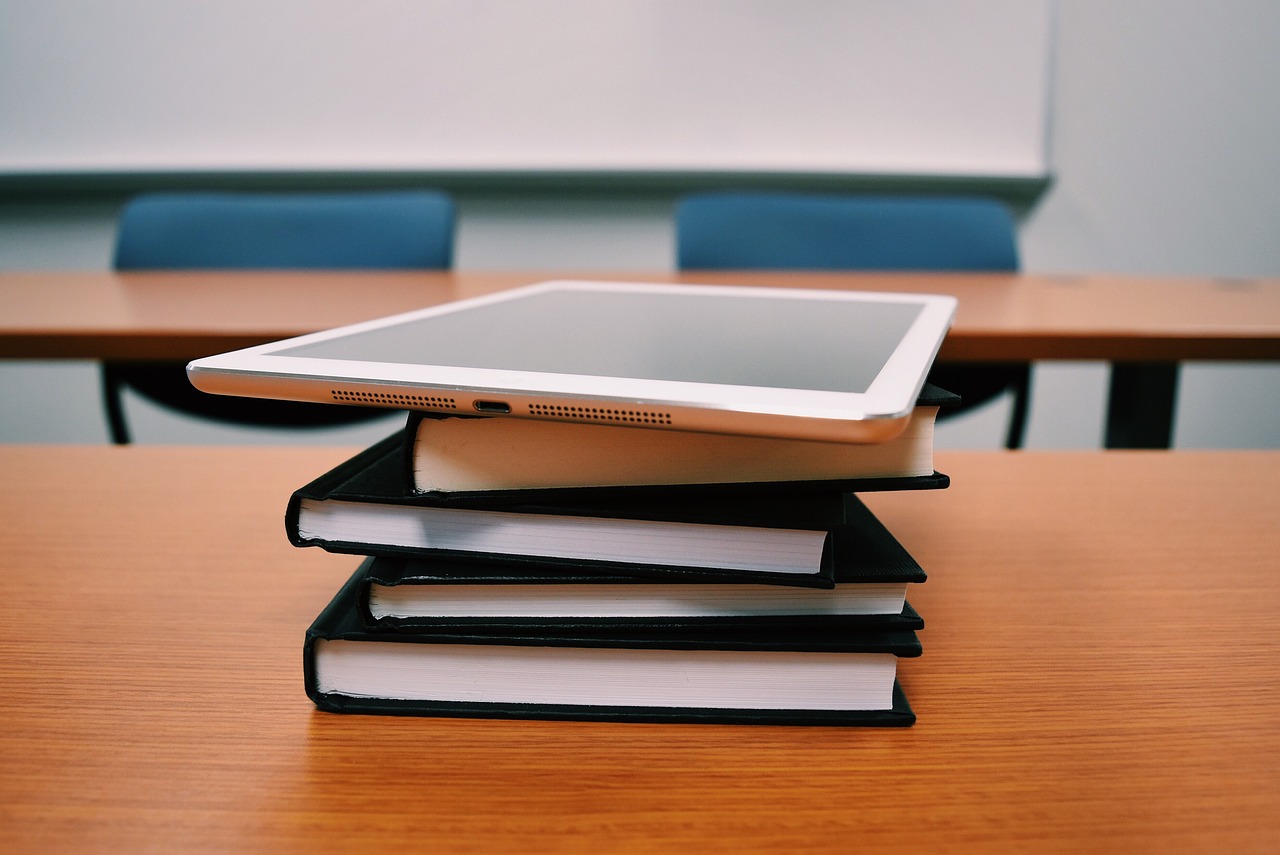
Neue Eigenständigkeitserklärung - verbindlich ab 01.04.2025
Jetzt mit Dokumentationspflicht bzgl. der Nutzung KI-basierter Tools
Nach eingehender Beratung mit allen Lehrenden und Studierendenvertreter:innen des Instituts für Katholische Theologie hat der Institutsvorstand am 12. Februar 2025 eine neue Eigenständigkeitserklärung für schriftliche Studien-/Prüfungsleistungen beschlossen. Diese beinhaltet neben den bisher gewohnten Selbstverpflichtungen zur vollständigen Dokumentation benutzter Quellen und Schriften nun auch die Dokumentationspflicht der Nutzung KI-basierter Hilfsmittel. Der Umfang der Nutzung und die genauer Art der Dokumentation von KI-Tools ist detailliert im Einzelfall zwischen betreffende Lehrperson und Studierende:r zu klären und festzuhalten.
Die neue Eigenständigkeitserklärung ist für alle schriftlichen Arbeiten (Hausarbeiten, Thesen, Portfolios, Bachelor-, Master- und Dissertationsarbeiten, etc.) ab dem kommenden Sommersemester, sprich ab 01.04.2025, verbindlich.
Weitere Infos und Anregungen zur differenzierten Reflexion und Dokumentation KI-basierter Tools im wissenschaftlichen Arbeiten finden sich in der niedersachsenweiten Handereichung KI-Gebrauch im Studienkontext dokumentieren (Baresel et al. 2024).
Für Fragen, Unterstützung oder auch weitergehende Beratung zur Begleitung und Dokumentation wissenschaftlicher Arbeiten mit KI-basierten Tools stehen der Institutsvorstand, die Fachschaft KT oder Severin Parzinger und Katharina Blischke zur Verfügung.
Die neue Erklärung findet sich hier als Word-Vorlage zum Download.
______________________________________________________________

Vorankündigung für SoSe 2025
Summer School vom 28. Mai bis 1. Juni im Kloster Huysburg
Die Juniorprofessur für Kirchen- und Christentumsgeschichte an der Universität Osnabrück und die Professur für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit an der Universität Erfurt veranstalten im Frühsommer 2025 gemeinsam eine Summer School zum Thema
"Christentum im geteilten und vereinten Deutschland 1949–1999".
Die Teilnehmer:innen erwartet ein vielfältiges Programm, das unterschiedliche Perspektiven auf christliche Lebenswelten in Ost- und Westdeutschland nach 1945 und auf die gemeinsame Geschichte seit der friedlichen Revolution 1989/1990 eröffnet. Thematische Sessions wechseln sich ab mit mehreren Kleingruppenworkshops. Eingerahmt sind diese von einer Abendveranstaltung mit Zeitzeugen und einer Lesung mit Thomas Brose sowie einer Exkursion nach Halberstadt.
Die Summer School steht allen interessierten Studierenden der Katholischen Theologie, Evangelischen Theologie und Geschichtswissenschaft sowie verwandter Studienfächer offen. Eine Teilnahme ist mit und ohne Anrechnung für konkrete Studienmodule möglich.
Weitere Informationen zu den Inhalten der Summer School und den einzelnen Terminen, zu möglichen Anrechnungen für konkrete Studienmodule und organisatorischen Fragen sowie zum Anmeldeverfahren erfahren Sie hier sowie bei der offenen Informationsveranstaltung:
_______________________________________________________

Prinzipalmarkt mit Lambertikirche in Münster (c) Günter Seggebäing, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (Ausschnitt)
Auf den Spuren der Täuferinnen und Täufer in Münster.
Eine erinnerungsgeschichtliche Exkursion im Rahmen des Täuferjubiläums (500 Jahre Täuferbewegung)
Zweiter Kirchengeschichtlicher Studientag der Evangelischen und Katholischen Theologie -
Ankündigung für Sommersemester 2025
Im Januar 1525 fand in Zürich die erste Glaubenstaufe statt. Daran erinnern dieses Jahr Gemeinden und Kirchen, die in der Tradition der reformatorischen Täuferbewegung stehen oder sich mit ihr verbunden fühlen, im Rahmen eines vielfältigen Veranstaltungsprogramms. 500 Jahre Täuferbewegung nehmen auch wir zum Anlass, um bei unserem zweiten Kirchengeschichtlichen Studientag der Evangelischen und Katholischen Theologie den Blick auf die Anfänge des Täufertums zu richten, aber auch gegenwärtige Lebensformen und Glaubenspraxis kennenzulernen. Unsere Reise führt uns nach Münster, Schauplatz des berüchtigten Täuferreichs. Wir werden uns zuerst auf die historischen Spuren desselben begeben, bevor wir die Baptistische Gemeinde vor Ort besuchen.
Datum: Mittwoch, 11. Juni 2025
Beginn: ca. 12.30 Uhr (Abfahrt in Osnabrück)
Ende: ca. 18.30 Uhr (Abfahrt in Münster)
Die Teilnahme ist kostenlos (An- und Abreise mit dem Semesterticket).
Anmeldefrist: 3. März bis 13. April 2025 über StudIP
Herzliche Einladung an alle interessierten Studierenden der Evangelischen und Katholischen Theologie (alle Studiengänge)!
Weitere Informationen: Plakat zur Veranstaltung (pdf)
___________________________________________________________

Prof. Dr. Martin Belz (Universität Osnabrück) mit Dr. Ringo Müller (Universität Erfurt) nach dem Vortrag (c) Universität Erfurt / Universität Osnabrück
Vortrag von Prof. Dr. Martin Belz beim Colloquium zur Zeitgeschichte des Christentums in Erfurt stieß auf großes Interesse
Am 7. Februar 2025 kamen zum nun fünften Mal die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erfurter Professuren für Kirchengeschichte und Zeitgeschichte zu ihrem gemeinsamen Colloquium zusammen. Diesmal durften sie Prof. Dr. Martin Belz, Inhaber der Juniorprofessur für Kirchen- und Christentumsgeschichte an der Universität Osnabrück, zum Abendvortrag begrüßen.
Martin Belz widmete sich in seinem Vortrag dem „Wormser Memorandum“ an Papst Paul VI. Dieses entsprang einer lokalen Initiative aus Worms im Jahre 1971, die das Ziel verfolgte, den katholischen Bann gegen Martin Luther aufheben zu lassen und somit zur ökumenischen Verständigung beizutragen. Entlang einzelner Quellen entwickelte Martin Belz die längere Vorgeschichte des Memorandums und seiner Initiatoren wie dem Philosophen Richard Wisser (1927–2019). Martin Belz zeigte hierbei auf, wie die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils, ein erwachtes Selbstbewusstsein kirchlicher Laiengremien und eine geschickte Medienstrategie zusammenkamen und für Worms und die Ökumene einen bleibenden symbolischen Erinnerungsort schufen.
Zur Lektüre dürfen wir gern weiterempfehlen: Von Luther zur Ökumene? Das „Wormser Memorandum“ (1971) im Kontext der 450-Jahr-Gedenkfeier des Reichstags von 1521, in: Claus Arnold/Martin Belz/Matthias Schnettger (Hrsg.), Reichstag – Reichsstadt – Konfession. Worms 1521 (Quellen und Abhandlungen zur mittelrheinischen Kirchengeschichte 148), Münster 2023, S. 173–197.
Mit der Veranstaltung wurde die Kooperation zwischen der Erfurter Professur für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit und der Osnabrücker Juniorprofessur für Kirchen- und Christentumsgeschichte vertieft. Zugleich loteten die Beteiligten inhaltliche Perspektiven für die kommende gemeinsame Summer School „Christentum im geteilten und vereinten Deutschland 1949–1999“ im Sommersemester 2025 aus.
Das Colloquium zur Zeitgeschichte des Christentums wird am 20. Mai 2025 mit Martin Höllen (Berlin) als Referenten fortgesetzt.
Weitere Informationen: Professur für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit der Universität Erfurt
____________________________________________________________

Exkursionsgruppe vor dem Aachener Dom (c) Universität Osnabrück | Foto: Natalie Giesen
Auf den Spuren Karls des Großen
Studierende und Lehrende auf Exkursion in Aachen, Mainz und Frankfurt am Main
26. Januar 2025
Wer war Karl der Große und welche Bedeutung hatte er für Religion, Gesellschaft und Politik im Mittelalter? Wie gestaltete sich kirchliches, religiöses und gesellschaftliches Leben in den Städten Aachen, Mainz und Frankfurt am Main in der Zeit von ca. 500 bis 1500? Welche Bedeutung hatten Klöster im Mittelalter – und welche bleibende Bedeutung haben sie bis heute?
Diesen und weiteren Fragen gingen 18 Studierende im Rahmen eines Seminars mit viertägiger Exkursion im Wintersemester 2024/2025 nach, das unter der gemeinsamen Leitung von Prof. Dr. Martin Belz (Universität Osnabrück) und Natalie Giesen (KHG Osnabrück) als Kooperationsveranstaltung stattfand. Die Lehrveranstaltung trug den Titel: "Auf den Spuren Karls des Großen - Religiöses Leben im Mittelalter zwischen Aachen und Frankfurt am Main".
Im Zentrum der Exkursion, die vom 9. bis 12. November 2024 von Aachen über die Klöster Eberbach und Eibingen im Rheingau nach Mainz und schließlich nach Frankfurt am Main führte, standen dabei Karl der Große, das religiöse, kirchliche und gesellschaftliche Leben im Mittelalter sowie Kunst, Kultur und Architektur der Zeit. Auch das interreligiöse Zusammenleben von Christ:innen und Jüd:innen, das monastische Leben sowie die Herausforderungen für Religionen und Kirche(n) in Vergangenheit und Gegenwart wurden exemplarisch thematisiert.
Den vollständigen Bericht zum Seminar mit Exkursion finden Sie hier.
________________________________________

Prof. Dr. Martin Belz (c) Universität Osnabrück | Jens Raddatz
Drei Fragen zum Religionsunterricht –
Prof. Dr. Martin Belz im Online-Interview mit der Schulabteilung des Bistums Osnabrück
Im aktuellen Online-Interview mit der Schulabteilung des Bistums Osnabrück beantwortet Prof. Dr. Martin Belz drei Fragen zum Religionsunterricht:
1. Welche prägende Erfahrung und/oder Erkenntnis haben Sie aus Ihrem eigenen Religionsunterricht mitgenommen?
2. Welche biblische Geschichte würden Sie für den Religionsunterricht als Anregung oder als besondere Herausforderung empfehlen?
3. Welche Erwartungen und/oder Hoffnungen verbinden Sie mit zukünftigem Religionsunterricht?
Zur Zukunft des Religionsunterrichtes hält er darin fest:
"Der Religionsunterricht der Zukunft sollte die gemeinsamen christlichen Traditionen, Glaubensüberzeugungen und Werte herausstellen, unabhängig davon, ob dies in einem konfessionellen oder interkonfessionellen Rahmen (etwa dem CRU) geschieht. Wichtig erscheint mir vor allem, dass Schülerinnen und Schüler in einer religiös zunehmend pluralen Welt eine religiös sensible Wahrnehmungs-, eine kritische Deutungs- und eine selbstbewusste und reflektierte Handlungskompetenz erwerben. Dazu zählen unter anderem der kritische Umgang mit religiösen Texten und ein Bewusstsein für eine religiös sensible Sprache. Im Religionsunterricht geht es nicht um die naive Kenntnis frommer Geschichten oder um ein reines Auswendiglernen von Glaubenssätzen (oder gar des Katechismus), sondern um die kritisch-offene Beschäftigung, Analyse und Deutung der konstruktiven und destruktiven, freud- und hoffnungsvollen sowie trauer- und angstbesetzten Ausprägungen von Religion(en) in Geschichte und Gegenwart. Religionsunterricht soll Schülerinnen und Schüler zum eigenständigen Denken und zur kritischen Auseinandersetzung mit religiösen Fragestellungen anregen und das Zusammendenken von Glaube und Vernunft ermöglichen."
Und mit Blick auf das Fach Kirchen- und Christentumsgeschichte fügt er an:
"Eine solche Beschäftigung mit (früheren) pluralen Lebenswelten und Glaubensvorstellungen, die im Sinne Andreas Holzems den Blick auf eine „Geschichte des ‚geglaubten Gottes‘“ weitet, ermöglicht etwa durch das Lernen an historischen Vorbildern und Beispielen eine kritische Auseinandersetzung mit Geschichte, die auch die bewusste Abgrenzung von den vorgestellten Beispielen seitens der Lernenden beinhalten kann. Damit bietet ein zukunftsfähiger Religionsunterricht Schülerinnen und Schülern konkrete (christliche) Identitätsangebote, ohne diese als normativ vorzuschreiben, und befähigt so zu einer eigenen (religiösen) Identitätsbildung."
Das vollständige Interview lesen Sie hier.
________________________________________________________________

(c) Universität Osnabrück | Foto: Emily Wesselkämper
Neue Mitarbeiterin an der Juniorprofessur für Kirchen- und Christentumsgeschichte
1. September 2024
Das Institut für Katholische Theologie begrüßt herzlich Kathleen Burrey M. Ed. als neue Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Kirchen- und Christentumsgeschichte. Nach dem Studium der Geschichte und Germanistik in Osnabrück und einem Referendariat in Bersenbrück hat Frau Burrey von 2020 bis 2024 im Projekt „Aufklärer in Staatsdiensten“ am Forschungszentrum Institut für Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit
der Universität Osnabrück mitgearbeitet, aus dem heraus auch ihre Dissertation über den Osnabrücker Aufklärer
Justus Möser (1720–1794) entstand.
An der Juniorprofessur für Kirchen- und Christentumsgeschichte wird Kathleen Burrey in einem neuen Forschungsprojekt das bikonfessionelle Zusammenleben im Fürstbistum Osnabrück in der Frühen Neuzeit untersuchen und die Professur in der Lehre unterstützen.
Die Mitarbeitenden des Instituts freuen sich sehr auf die Zusammenarbeit und wünschen Frau Burrey
viel Freude und Erfolg für ihre Tätigkeit.
_______________________________________________________________

NOZ-Lebenswelten: Theologie studieren in Osnabrück
Die drei Osnabrücker Theologien werben in diesem Jahr gemeinsam für das Theologiestudium an der Universität Osnabrück.
Zu der konzertierten Massnahme gehört auch ein Porträt dreier Studierender in den NOZ-Lebenswelten.
_______________________________________________________________________________________
SPRACHANFORDERUNGEN FÜR DIE STUDIERENDEN DER KATHOLISCHEN THEOLOGIE
nach der Verordnung über Masterabschlüsse für Lehrämter in Niedersachsen (Nds. MasterVO-Lehr) vom 2. Dezember 2015
Lehramt an GRUNDSCHULEN
fachbezogene Grundkenntnisse in Latein
--------------------------------------------------------
Lehramt an BERUFSBILDENDEN SCHULEN
fachbezogene Grundkenntnisse in Latein
--------------------------------------------------------
Lehramt an HAUPT- UND REALSCHULEN
fachbezogene Kenntnisse in Latein
--------------------------------------------------------
Lehramt an GYMNASIUM
1. Graecum oder fachbezogene Kenntnisse in Griechisch
oder
Hebraicum oder fachbezogene Kenntnisse in Hebräisch
und
2. (Kleines Latinum) oder fachbezogene Kenntnisse in Latein
Fachbezogene Grundkenntnisse = 1 Uni-Kurs über 1 Semester (Einführung in die Sprache im WS)
Kenntnisse = 2 Uni-Kurse über 2 Semester (Einführung + Aufbaukurs im SS)
Erläuterung zu Latein:
In Osnabrück werden schulische Leistungen in Latein anerkannt, auch wenn Latein nicht bis zum Latinum fortgeführt wurde: Wer auf der Schule 1 Jahr Latein gelernt hat = Grundkenntnisse, wer 2 Jahre Latein hatte = fachbezogene Kenntnisse! Die Anerkennung erfolgt nur in der Sprechstunde von Prof. Dr. G. Steins nach Vorlage der Schulzeugnisse im Original. Wenn auf dem Abiturzeugnis das (Kleine) Latinum bescheinigt ist, sind alle Bedingungen erfüllt; eine weitere Bescheinigung ist dann nicht nötig! Das Abiturzeugnis reicht als Bescheinigung aus.
Alle Fragen richten Sie bitte an Prof. Dr. Georg Steins (am besten in der Sprechstunde)
______________________________________________________________________________

